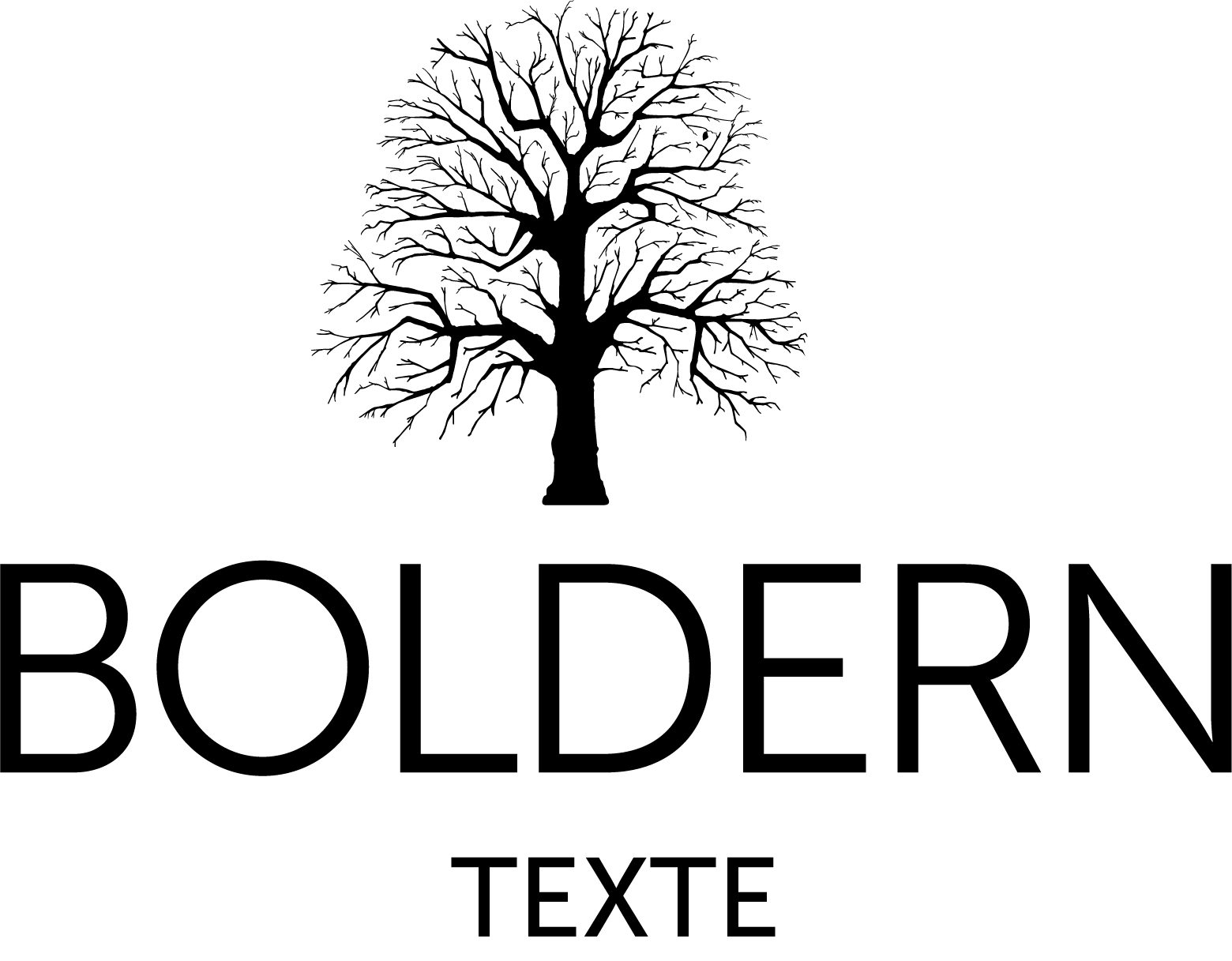Passionslieder – fremd im Wort, nah in der Musik
Unser Autor Andreas Marti war Mitglied der «Kleinen Gesangbuchkommission», die von 1984 bis 1998 das neue Reformierte Gesangbuch geschaffen hat. Er geht hier auf die darin enthaltenen Passionslieder ein.
Als der Entwurf zum Reformierten Gesangbuch zu Ende beraten war, führten wir in der «Kleinen Gesangbuchkommission», der Fachkommission, die Schlussabstimmungen über die einzelnen Teilkapitel durch. Ich habe dem Passionskapitel meine Zustimmung verweigert, wohl wissend, dass wir es angesichts des dürftigen Angebots an brauchbaren neueren Passionsliedern nicht wesentlich besser hätten machen können.
Die traditionellen Lieder liegen mit ihrem Verständnis der Passion weitgehend auf der Linie der Sühneopfertheorie: Gott zürnt wegen der Sünde der Menschen und muss durch ein Opfer besänftigt werden, ein Opfer, das die Menschen bringen müssten, das sie aber wegen der «Erbsünde» (über dieses höchst problematische Konstrukt wäre separat zu diskutieren) nicht bringen können. Nur Gott selber ist dazu imstande. So gibt Christus als wahrer Gott und wahrer Mensch sein Blut zum Lösegeld.
Diese Theorie hat vielleicht den Menschen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit geholfen, ihre Angst vor dem ewigen Verlorensein im Zaum zu halten. Dass sie aber fast die einzige Art war, wie die Passionsberichte der Evangelien verstanden wurden, hat diese eingeengt und sie der Weite ihrer Bedeutungen beraubt. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu standen ja vor der Aufgabe, Leiden und Tod ihres Meisters irgendwie zu verstehen, dem zunächst Sinnlosen im Licht der Erfahrungen von Ostern einen Sinn zu geben. Es lag nahe, dazu Gedanken aus den überlieferten Schriften, unserem Alten Testament, heranzuziehen. Ein solches Deutungsmuster bieten die Lieder vom Gottesknecht im Buch des «Zweiten Jesaja» (Jes 40–55). Der Gottesknecht leidet stellvertretend für das Volk. Dazu kommen aus der Tora, dem mosaischen Gesetz, Vorstellungen über die sühnende Kraft des Opfers, und beides zusammen führt in der Folgezeit zur beschriebenen Sühneopfertheorie.
Einen etwas anderen Ansatz finden wir im «Christushymnus» des Philipperbriefs, der von der Selbsterniedrigung des Gottessohnes spricht. Dort erscheint der Tod am Kreuz als letzte Konsequenz der Menschwerdung Gottes: Gott kommt bis in die dunkelsten und schlimmsten Orte des Menschenlebens. Seine Nähe gilt auch und gerade da, wo Menschen von allen Menschen verlassen und von allen Lebensmöglichkeiten abgeschnitten sind. Gott ist solidarisch mit den Schwächsten, mit den Menschen in Unglück und Not.
Auch wenn wir weitere biblische Gedanken anführen würden, kämen wir doch nicht zu einer eindeutigen und erschöpfenden Deutung. Die Bibel selbst versucht es mit unterschiedlichen Ansätzen, und dabei bleiben Leerstellen, die für einen unaufhörlichen Prozess des Verstehens offen sind, ein Verstehen, in welches wir mit unserer Existenz mit hineingenommen werden, ohne dass wir alles ausformulieren können. Im Grunde lässt sich alles zurückführen und verdichten auf ein pro nobis, auf die Überzeugung, dass all das «für uns» geschehen ist, was immer es im Einzelnen bedeuten mag. Vielleicht ist es diese Art des Verstehens, welche beispielsweise Bachs Passionen nach beinahe 300 Jahren immer noch aktuell hält. Die Musik löst sich von den barocken Texten und führt uns auf die Ebene des offenen «für uns», das wir nicht weiter definieren müssen.
Aber nun zurück zum Gesangbuch. Das vielleicht bekannteste Passionslied ist Paul Gerhardts O Haupt voll Blut und Wunde (RG 445). Es geht zurück auf einen mittelalterlichen Meditationstext, in welchem der Beter nacheinander die Körperteile des Gekreuzigten betrachtet, von den Füssen bis zum Kopf. Obschon auch für dieses Lied die Sühneopfertheorie den Hintergrund bildet, ist der Schlüssel zum Verständnis hier doch ein anderer: «Ich» stehe vor dem Kreuz und schaue den Gekreuzigten an, und dieses Hinblicken bekommt seine entscheidende Bedeutung im Angesicht des eigenen Todes, wie es die letzten beiden Strophen beschreiben: Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Dieses Hinschauen schafft die Verbindung des Sterbenden mit demjenigen, der in seinem Sterben den Tod besiegt hat – eine Interpretation, welche die Passionsgeschichte tief in die eigene Existenz einfügt, bei der aber manche problematischen Elemente der Tradition und viel barocke Emphase ausgeblendet werden müssen.
Interessanterweise hat Martin Luther kein eigentliches Passionslied gedichtet. Vielmehr hat er im Osterlied Christ lag in Todesbanden (RG 464) Passion und Ostern integriert. Das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Von der compassio, dem emotionalen Anteilnehmen am Leiden Christi, hielt Luther bekanntlich nicht viel. Ihm geht es um das klare Glaubenserkenntnis, dass Gott alles für uns tut und dafür sogar seinen Sohn in den Tod gehen lässt. Das ist freilich zunächst auch wieder das Muster der Sühneopfertheorie, aber Ziel des Gedankens ist die «Rechtfertigung aus Gnade» – dass wir vor Gott ohne eigene Leistung gerecht sind. Das blosse «für uns» konkretisiert sich in einem ebenso knappen «allein aus Gnade».
Das kurze «für uns» prägt die mittelalterliche Passionsweise Ehre sei dir Christe (RG 435) und auch das als Kinderlied gedachte Wir danken dir, Herr Jesu Christ (RG 439), während das 17. Jahrhundert dann die Sühneopfertheorie breit ausformuliert. Christian Fürchtegott Gellert, der bedeutendste Kirchenliedautor des Aufklärungszeitalters im 18. Jahrhundert, legt seinem Lied Du gingst, o Heiland, hin für uns zu leiden (RG 448) ebenfalls die klassische Sühnetheorie zugrunde, ändert dann aber von der zweiten Strophe an die Blickrichtung, und zwar auf die Einheit der Jüngerinnen und Jünger Jesu im gemeinschaftlichen Mahl, auf den Frieden und auf die Liebe: Wenn wir in Frieden beieinander wohnten, Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten, dann würden wir den letzten heilgen Willen des Herrn erfüllen. Neben die klassische Interpretation tritt eine Art «Vorbildchristologie», von der traditionellen Theologie als oberflächlich abgetan, aber im Ruf zur Nachfolge biblisch begründet: Das Leiden soll nicht Hass erzeugen, sondern die Liebe bewahren, wie Gellert es in seinem anderen Passionslied schreibt, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (RG 449), oder im Lied Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte» (RG 450), wie wir es beim Herrnhuter Karl Bernhard Garve lesen.
Von den neueren Liedern steht Was ihr dem geringsten Menschen tut (RG 457) in dieser Vorbildtradition, aber im umgekehrten Sinne: Im leidenden Mitmenschen begegnet uns der leidende Christus. Gottes Solidarität ruft uns zur Nachfolge in unserer Solidarität mit den Schwachen und Leidenden. Andere Lieder verbinden – wie Luther – Passion und Ostern und besingen die Überwindung des Todes: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (RG 456), Du schöner Lebensbaum des Paradieses (RG 454) und Holz auf Jesu Schulter (RG 453). Das «Hinsehen», das in Gerhardts Lied so wichtig ist, begegnet uns wieder in Seht hin, er ist allein im Garten (RG 452). Es ruft uns dazu auf, nicht wegzusehen: So, wie wir auf die Passion Jesu schauen, sollen wir uns auch dem Leiden unserer Zeit stellen. Zum Sehen kommt das Hören: Auf die knapp gefasste Passionserzählung reduziert ist Hört das Lied der finstern Nacht (RG 455). Das Passionsgedenken wird auf die fast unkommentierte Erzählung zurückgeführt und bleibt in dem Sinne bedeutungsoffen, wie es oben angedeutet wurde. Einzig der Schlusssatz gibt eine Interpretation des «für uns»: … reisst durch seinen Tod uns aus Nacht und Not.
Von Andreas Marti