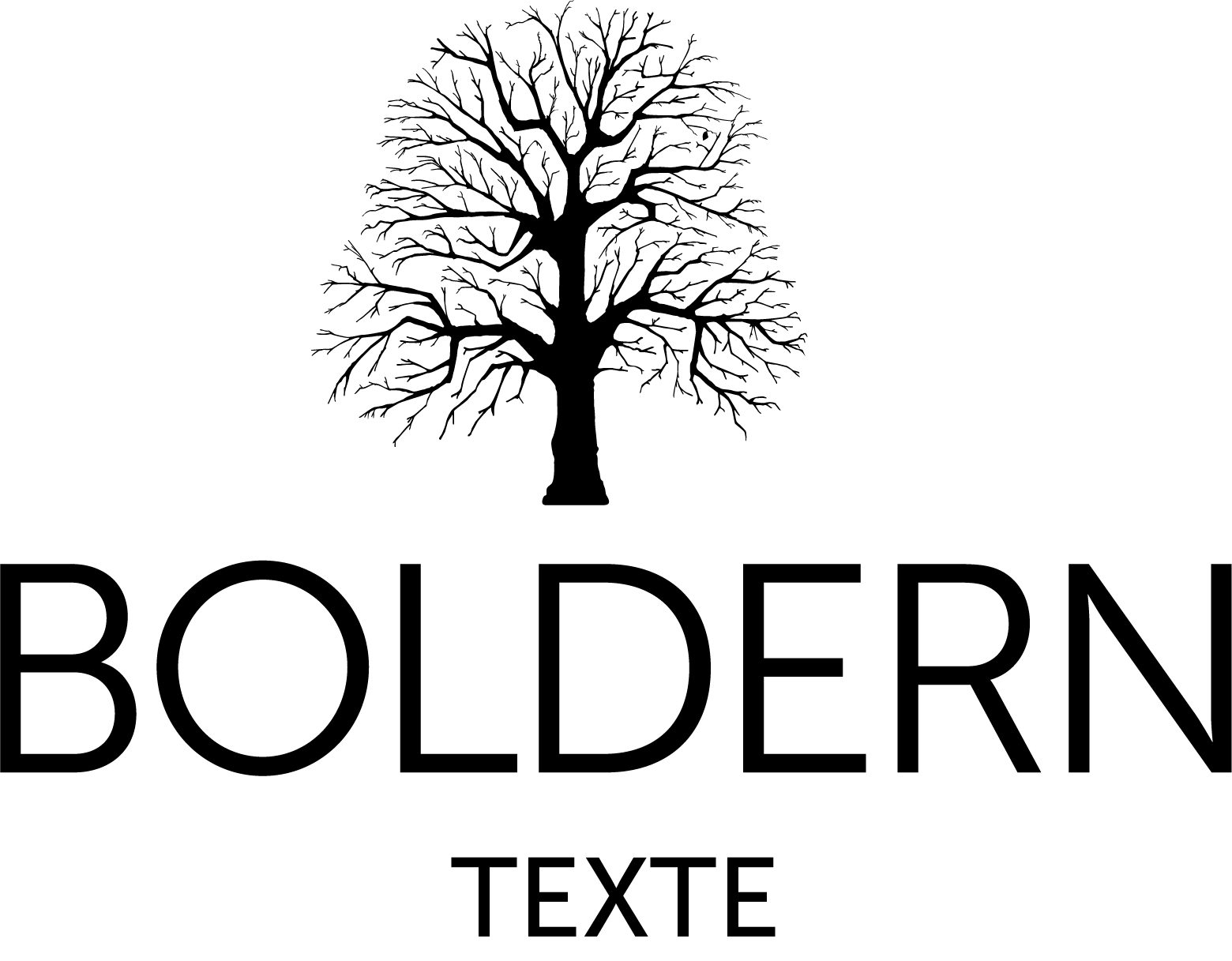Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel
sein über einen Sünder, der Busse tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die der Busse nicht
bedürfen. Lukas 15,7
Von Umkehr war gestern die Rede. Heute doppeln wir nach.
Sünde, Sünder, sündigen: eine der schwierigeren Wortgruppen
der biblischen und kirchlichen Sprache. Sünden als
einzelne Handlungen zu bezeichnen, ist umgangssprachlich
geläufig, verharmlost aber, was hinter dem Begriff steht,
nämlich die existenzielle Situation des Menschen, die ihn in
der Distanz zu Gott gefangen hält. Reformatorische Theologie
hat sich tief und eingehend mit dem Schicksal des
«Sünders» befasst, der durch Gott selbst aus dieser Distanz
befreit wird. In neuerer Zeit ist eine Ausweitung des Begriffs
nötig geworden: Unheil entsteht nicht nur durch Handlungen
Einzelner, sondern durch Strukturen, die individuell
meist nur schwer beeinflussbar sind, was als «strukturelle
Sünde» bezeichnet wird. Busse ist dann mehr als ein ausgleichender
Akt. Im Sinne des Neuen Testaments geht es
wörtlich um die Sinnesänderung, die Umkehr des Denkens.
Das mag individuell verstanden werden als das Bemühen
um eine moralische Lebensänderung. Es braucht aber heute
mehr: den Einsatz für eine Welt mit weniger «struktureller»
Sünde. Das ist politisch, und so kann es denn keinen apolitischen
Glauben geben, wenn wir das Neue Testament in
unserer Zeit ernst nehmen.
Von: Andreas Marti