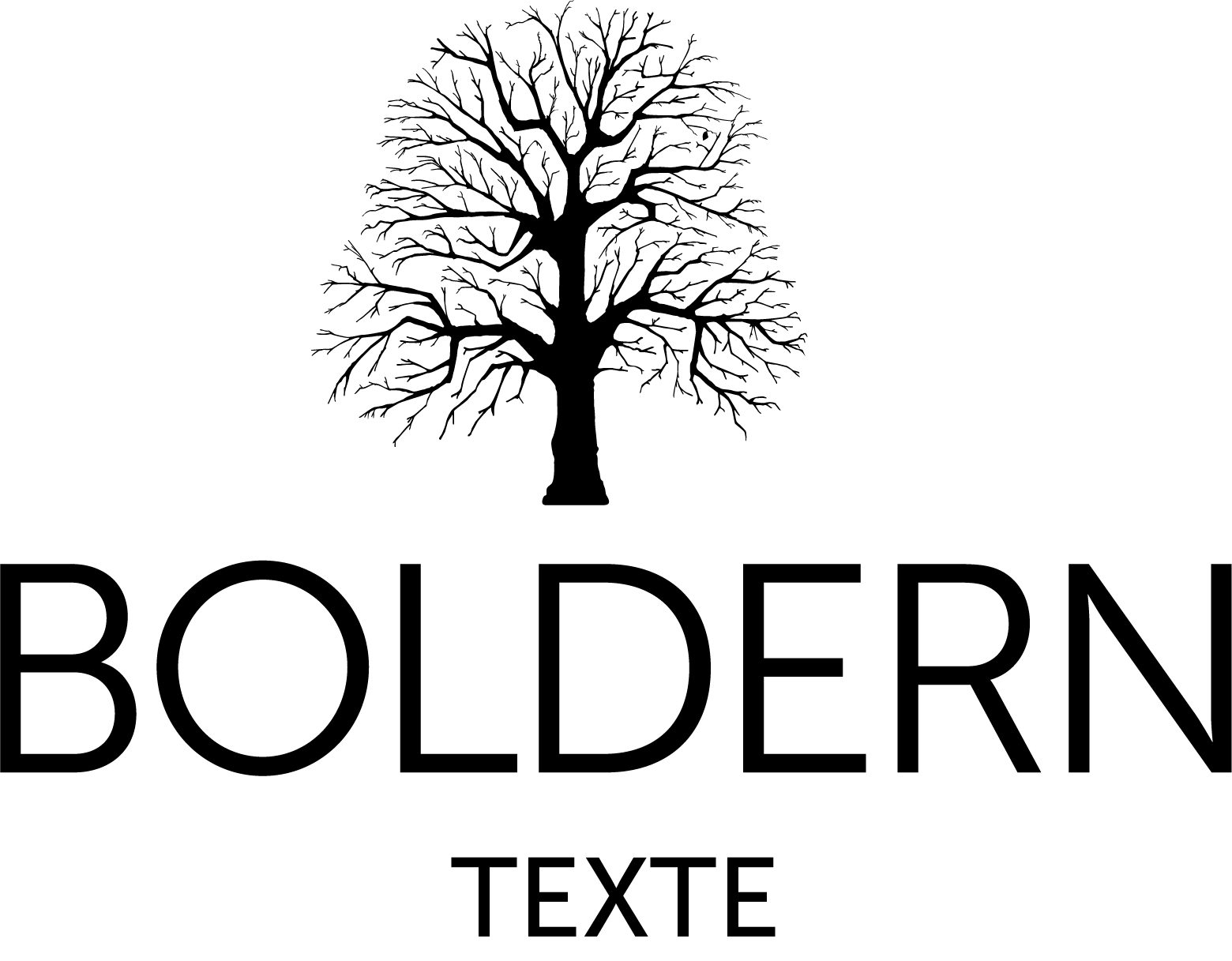Als Mose seine Hand über das Meer reckte, liess es der HERR zurückweichen durch einen starken Ostwind. 2. Mose 14,21
Ich stehe am Strand. Die Wellen geben den glitzernden Sand frei, die schwarz schillernden, mit Muscheln übersäten Felsen, um sie sogleich wieder zu verschlucken. Barfuss im Sand stehen, sich umspülen lassen. Ich spüre, wie ich einsinke. Die Wellen rütteln an mir. Ich halte stand. Den Wind im Gesicht, das Salz auf der Zunge, nichts als die Brandung im Ohr. Manchmal denke ich, Gott wohnt im Meer.
Mir kommt ein Lied der «Einstürzenden Neubauten» in den Sinn: «Und umgekehrt, wenn du bist, wild, und laut und tosend deine Brandung, in deine Wellenberge lausch ich, und aus den höchsten Wellen, aus den Brechern, brechen dann die tausend Stimmen, meine, die von gestern, die ich nicht kannte, die sonst flüstern, und alle anderen auch, und mittendrin der Nazarener; immer wieder die famosen, fünf letzten Worte: Warum hast du mich verlassen? Ich halt dagegen, brüll jede Welle einzeln an: Bleibst du jetzt hier?»
Es gibt Momente, in denen das Meer zurückweicht wie bei Mose. Die Wellen holen Atem und legen den Urgrund des Vertrauens frei jenseits der Worte. In der flüchtigen, unverhofften Euphorie beim Musikhören. Oder in der Getrostheit, gefunden worden zu sein. Sie lassen sich nicht festhalten, aber sie umspülen mich wie Wellen des Glücks.
Von Felix Reich