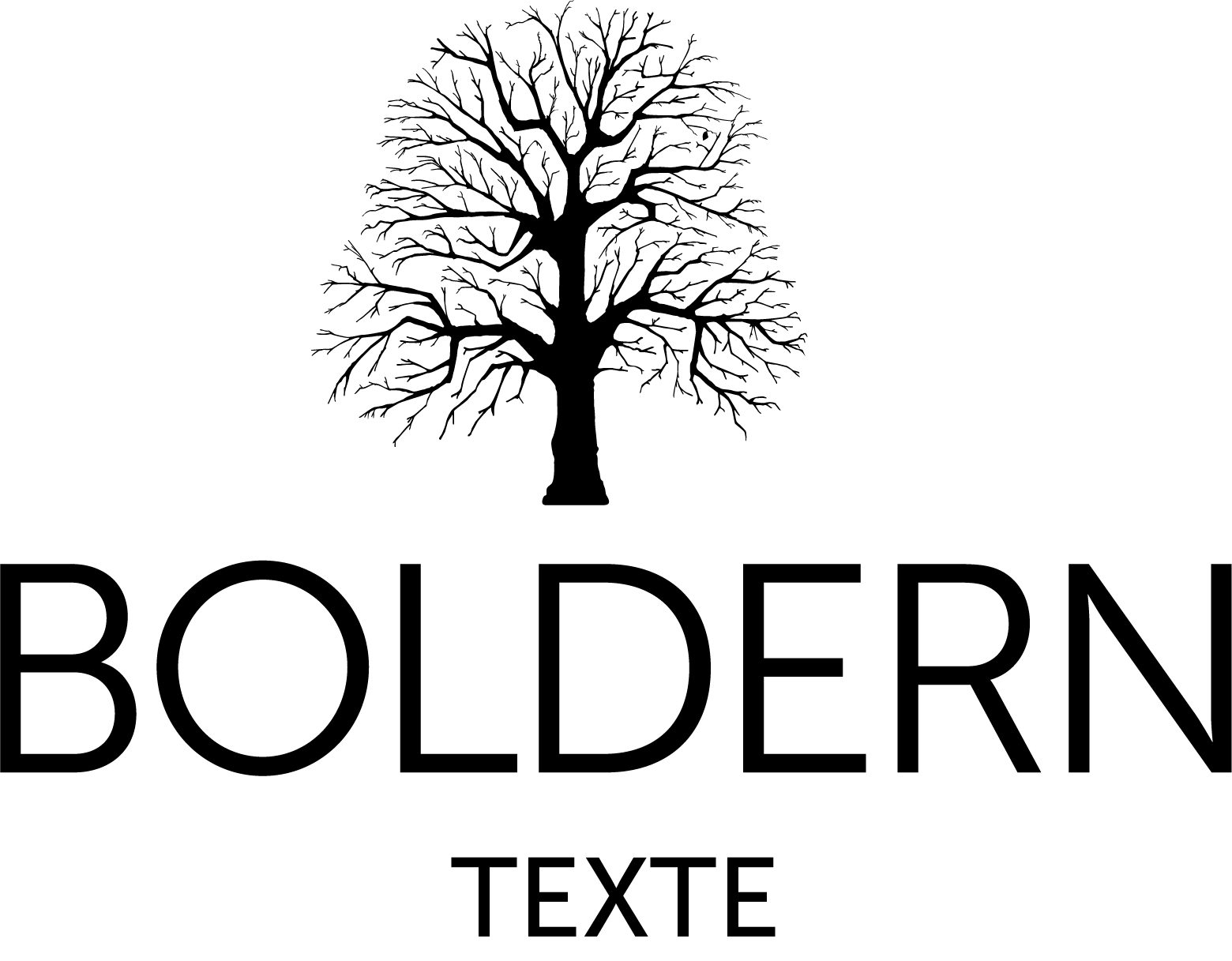«mächtig stolz»
«mächtig stolz» – das ist der Titel einer Textsammlung, die im Mai erschienen ist. 70 Frauen erinnern sich an die Anfänge und Entwicklungen der feministischen Theologie und der Frauen-Kirche-Bewegung in der Schweiz. Eine von diesen Autorinnen ist Ihnen wohlbekannt: Reinhild Traitler. Im Folgenden ein Ausschnitt aus ihrem Text über ihre Jahre als Studienleiterin von Boldern von 1984 bis 2003.
… Das am Fuss des Zürichbergs in der Voltastrasse gelegene Boldernhaus war das Stadthaus des Evangelischen Tagungszentrums Boldern bei Männedorf …
Das Boldernhaus war schon seit längerer Zeit schwerpunktmässig ein «Frauenhaus» gewesen. In der Wohnung im zweiten Stock, in die ich nun einziehen würde, hatten viele Jahre lang zwei Ikonen der Schweizer Frauenbewegung residiert: Marga Bührig und Else Kähler.
… Feminismus – die Vokabel war mir damals zwar bereits geläufig, aber noch etwas blass. Ich hatte jahrelang mit gescheiten Männern zusammengearbeitet, für welche die Frauenfrage ein «Nebenwiderspruch» war. Zudem machte ich im ÖRK immer wieder die Erfahrung, dass Frauen ihre Anliegen in einer anderen Sprache und durch andere Vermittlungen darstellen wollten und deswegen oft nicht gehört oder ernst genommen wurden. Auch war das, was wir feministische Theologie nannten, kein Monolith, sondern eher ein Konglomerat, das die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen unter dem Stichwort «Erfahrung» ebenso einbezog wie kreative Formen des Ausdrucks oder liturgische Experimente wie ein «Abendmahl am Küchentisch». Wir fragten nach, inwieweit der weibliche Körper die soziale Existenz von Frauen geprägt hatte und noch prägte und wie das sichtbar gemacht werden konnte …
… Die viel zu grossen Erwartungen und die Hoffnung, dass daraus dennoch etwas werden könnte, all das stand auf einmal vor mir bei meinem Einzug ins Boldernhaus in diesem August 1984. Als wir im Eiltempo die Wohnung eingerichtet hatten, waren auch schon die Frauen an der Tür, die mir helfen wollten, das Haus nach der Pensionierung von Marga Bührig und Else Kähler neu zu positionieren. Einige von ihnen hatte ich in den Anfangswochen in Zürich bereits kennengelernt. Besonders Pfarrerin Dora Wegmann war in dieser Zeit des Sich-Zurechtfindens eine grosse Hilfe. Bei vielen Tassen Kaffee hörte ich von der langen Tradition von Frauenarbeit im Boldernhaus, die vor allem auf Angebote zur Lebenshilfe fokussiert war.
Bei diesen Gesprächen mit einem langsam grösser werdenden Kreis von Frauen ging es letztlich immer wieder um die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Leben, auch im öffentlichen Leben der Kirchen; also um die Teilhabe von Frauen an der Macht und damit an der Möglichkeit, das Leben der Gemeinschaft mitzugestalten. Schliesslich ging es auch um die kritische Betrachtung des privaten Raums als eines ambivalenten Ortes, wo Frauen nicht nur Schutz erhielten, sondern auch Gewalt erlitten. Schon damals und nicht erst mit der #MeToo-Bewegung haben sich Frauen mit sexueller Gewalt in all ihren Formen auseinandergesetzt: von der unsichtbaren häuslichen Gewalt bis zu brutalster sexueller Gewalt an Frauen als Mittel der Kriegsführung, etwa im Bosnienkrieg.
Theologisch fragten wir nach, was es bedeutet, dass die Menschen im biblischen Schöpfungsverständnis nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Da sie sich von diesem Gott kein Bildnis machen dürfen, waren sie auf Bilder von sich selbst zurückgeworfen. Und da mussten Frauen entdecken, dass Gottebenbildlichkeit in der christlichen Tradition weitgehend Mann-Ebenbildlichkeit bedeutet hatte. Frauen wurden von Männern gedacht, beschrieben, gemalt, besungen, aus der Perspektive von Männern «erfunden» und beherrscht. Kurz: Die Definitionsmacht über weibliche Existenz hatten Männer …
… Die entstehende Arbeits- und Begleitgruppe «Feministische Theologie» war sich bald einig: In den kommenden Jahren wollten wir uns schwerpunktmässig mit den Gottes- und Menschenbildern unserer Tradition auseinandersetzen und nachfragen, ob und wie in ihnen Erfahrungen von Frauen gespiegelt sind: Unterdrückungserfahrungen, aber auch Utopien von Befreiung und gelungenem Leben. Und welche Konsequenzen das für ein Frauen-Menschenbild hätte.
Mit dabei war nun auch Gina Schibler, die junge Pfarre- rin, die der Vorstand des Boldernvereins für das Ressort «Persönliche Lebensgestaltung» ins Studienleitungsteam gewählt hatte und die 1985 ihre Arbeit aufnahm. Wir waren uns schnell einig, dass wir ein grösseres feministisch-theologisches Projekt gemeinsam entwickeln wollten.
Von Reinhild Traitler
«mächtig stolz». 40 Jahre Feministische Theologie und Frauen-Kirche-Bewegung in der Schweiz, hg. von Doris Strahm und Silvia Strahm Bernet, unter Mitarbeit von Monika Hungerbühler, eFeF-Verlag, 2022. ca. 300 Seiten, Fr. 40.–.